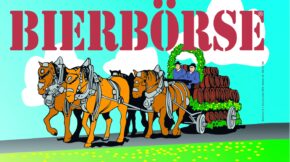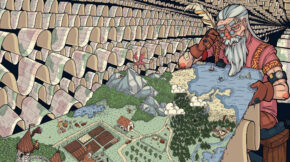Gekommen, um zu bauen

Was kreucht und fleucht im STUZ-Gebiet: Wilde Tiere vor der Haustür, Teil 50: Der Biber
von Konstantin Mahlow
Fußgänger und Fahrradfahrer staunten in den letzten Wochen sicher nicht schlecht: An der Mainmündung auf der Maaraue knabberte ein zunächst noch unbekannter Auenbewohner einen Baum so arttypisch an, dass schnell der Verdacht auf eine am Rhein längst ausgerottete Spezies fiel. Die Fraßspuren wurden von einem Passanten dokumentiert und online gestellt. Eine leicht ungläubige Gemeinschaft spekulierte daraufhin, ob es sich nicht um eine größenwahnsinnige Nutria handelt oder ob sich jemand einfach einen Spaß erlaubt, bis der NABU Wiesbaden den Sachverhalt aufklärte: Tatsächlich lebt seit einigen Jahren ein einzelner Biber im Bereich der Mainspitze, vermutlich der erste seit vielen hundert Jahren. Dementsprechend ist auch der Baum, den das Tier zur Fällung ausgewählt hatte, ein lange vergessener Anblick im STUZ-Gebiet, an den man sich vielleicht wieder gewöhnen muss.
Der Europäische Biber (Castor fiber) ist mit maximal 30 Kilogramm Gewicht und einer möglichen Gesamtlänge vom Kopf bis zur Schwanzspitze von 1,30 Meter das mit Abstand größte Nagetier Europas. Die streng vegan lebenden Tiere sind als semiaquatische Art an Gewässer und deren Uferbereiche gebunden. Zwar wohl kaum aus der hiesigen Natur, aber doch aus zahllosen Dokumentationen sind sie den meisten Menschen als wahre Baumeister bekannt, die mit ihren handwerklichen Tätigkeiten in der Lage sind, ganze Landschaftsbilder zu verändern. Für den Bau der berühmten Biberburgen fällen sie reihenweise Bäume und transportieren zudem Schlamm, Steine und Geäste zu ihrer Baustelle, um die Außenwände zu stabilisieren. Die Eingänge zu dem trockenen Wohnkessel im Inneren der Burg sind zur Sicherheit immer unter Wasser angelegt. Fällt der Pegel darunter, wird der Bau entweder aufgegeben oder der Biber legt kurzerhand einen Damm an und staut das Wasser, bis der Pegel wieder steigt. Auch dafür dienen ihm am Ufer wachsende Bäume.
Eine zehn Meter breite Burg mit angelegtem Hausteich ist nicht nur ein beeindruckender Anblick: kleine Flüsse können durch Meister Biber und seinen Dämmen ihren kompletten Verlauf ändern, wodurch Wiesen überflutet oder andere Bereiche trockengelegt werden. Für die Natur ist diese Umstrukturierung ein Segen. Doch sie gestalten die Landschaft auf eine Art und Weise um, von der der Mensch glaubte, dass er als einzige Art das Recht dazu habe. Es kann nur einen Chef auf der Baustelle geben, und wenn die Wiese neben dem Bach für das Vieh oder den Mais reserviert war, konnten die unterschiedlichen Vorstellungen der Landschaftsgestaltung zu ernsthaften Konflikten führen – mit dem meist besseren Ende für die Zweibeiner. Biber wurden als Schädlinge gejagt und dezimiert, ihre Lebensräume zudem zerschnitten und verschmutzt. Im Mittelalter, als es sie noch zahlreich gab, wurden sie gerne zur Fastenzeit gejagt und verzehrt, da die Kirche sie aufgrund ihrer Lebensweise im Wasser und dem platten Schwanz praktischerweise als Fische kategorisierte.
Vor allem aber ihr wasserdichtes Fell und ein als „Bibergeil“ oder „Castoreum“ bezeichneter, angeblich heilender Dunststoff, mit dem die Nager ihre Reviere markieren und von dem sie ihren lateinischen Namen haben, wurde ihnen zum Verhängnis. Massenhaft wurden sie erlegt und erst viel zu spät unter Schutz gestellt. In Hessen galt der Biber seit 1596, in Rheinland-Pfalz seit 1840 als ausgerottet. Doch in den letzten Jahrzehnten haben sie beinahe unbemerkt ein Comeback gefeiert. Renaturierungsprojekte wie an der rheinhessischen Selz, natürliche Einwanderungen aus dem Elsass sowie eine äußerst erfolgreiche Wiederansiedlung im Spessart ebneten den Weg für eine Rückkehr ins STUZ-Gebiet. Die Biber sind auf der Suche nach neuen Lebensräumen und trauen sich dabei offensichtlich auch näher an die Zivilisation ran als bisher.
Dass es am Hauptstrom des Rheins inmitten einer Metropolregion – mit Ausnahme einiger Auengebiete – kaum Raum und Platz für die Baukünste der französischen und hessischen Einwanderer geben wird, ist leider absehbar. Doch die allermeisten Biber setzen sich sowieso nicht an Orten wie der Maaraue ab, sondern benutzen den Rhein als Autobahn auf dem Weg zu kleineren Nebenflüssen oder ruhigen Altrheihnarmen. Dort dürfte ihre Zahl in den nächsten Jahren steigen – und damit auch das Konfliktpotenzial mit anderen Bauherren. Vor allem in Bezug auf die Unterminierung menschengemachter Dämme muss sein Arbeitsdrang im Auge behalten werden. Gelingt die Koexistenz, werden wir in Zukunft mit Sicherheit noch öfter auf angenagte Bäume stoßen. Und vielleicht auch mal auf eine echte Burg.
Foto: Ryzhkov Sergey, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons