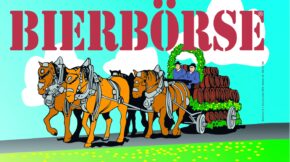Fernfamilie

Manchmal lebt die eigene Familie nicht im Nachbardorf. Zwischen Nähe und Distanz schlummern eine Reihe eigenartiger Gefühle.
von Princesha Salihi
Mein kürzlicher Urlaub in Kosovo und Albanien war nicht besonders urlaubig. Das liegt nicht daran, dass es dort nicht schön sei. Doch als ich zuhause in Mainz ankomme, freue ich mich endlich im eigenen Bett schlafen zu können. Und ich freue mich über die Ruhe, die einkehrt. Ein Besuch alle paar Jahre in Prishtina geht mit einer übervollen Agenda einher: Am Morgen im Café mit der Cousine, am Nachmittag die Oma im Dorf besuchen und zum Abendessen bei der Tante. Während ich noch vor nicht allzu langer Zeit unbeschwert am Kindertisch saß, ordnete man mich jetzt den Erwachsenen zu. Am Erwachsenentisch gab es dann Gespräche über Politik und die Liebe, Fragen zu meinem Studium und Antworten zu meiner Arbeit. Das Update der neusten Version von mir hatte Schwierigkeiten beim Laden. Ganz unschuldig daran war ich nicht. Mit jedem verstrichenem Jahr, nahm die Anzahl der geschriebenen Nachrichten und Telefonate ab und die gefühlte Distanz zu.
Zu meiner Überraschung ging auch für die anderen das Leben weiter. Die Wünsche und Träume meiner Cousinen und Cousins zu hören, versetzte mich in eine unangenehme Position mit ambivalenten Gefühlen. Es gibt einen passenden Ausdruck für derlei Gefühle. Der „survivour guilt“ [dt. Überlebensschuld] beschreibt die Schuldgefühle, die man dafür empfindet, in einem sicheren Land zu leben. Es herrscht kein erklärter Krieg in Kosovo und Albanien, aber die politische Lage ist angespannt. Noch schwerer wiegt die wirtschaftliche Lage. Viele junge Menschen sitzen mit ihren Uni-Abschlüssen zu Hause oder nehmen an den Losverfahren verschiedener Botschaften um Arbeitsvisa teil. Für mich selbst anzuerkennen, dass wir es zwar in Deutschland nicht leicht hatten, dass sich jedoch trotzdem viele Menschen wünschen an meiner Stelle zu sein, ist so simpel wie schwer.
Dem Internet sei Dank
Meine Mutter hat eine sehr enge Bindung zu ihren Schwestern. Diese auf einen Schlag durch Flucht und Migration zu verlieren, war hart. Was sie anfänglich mit Briefen und teuren Auslandstelefonaten versuchten aufrechtzuerhalten, wurde irgendwann durch Internettelefonie und Smartphones erleichtert. Dem Internet sei Dank! Man kann zu jeder Tageszeit unbegrenzt telefonieren und wer das möchte, kann sich sogar dabei sehen.
Auch wenn ich weiß, dass das für meine Eltern einen großen Mehrwert gebracht hat, ist das für mich nicht der Fall. Ich finde telefonieren anstrengend – wie es sich für eine Gen-Zlerin eben gehört. Es bringt mir nicht die Form von Verbindung, die ich aus einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht ziehe. Im Gegenteil: Mit jedem Telefonat, jeder rauschenden Leitung, mit jedem Kratzen im Hörer wird die symbolische Telefonschnur immer länger, der Zwischenraum immer größer. In jedes „Ich verstehe dich nur ganz schlecht“ und „Kannst du das bitte nochmal wiederholen?“ legt sich die Distanz wie eine fette, träge Katze, die gerne einen Winterschlaf machen würde, aber nicht kann. Ich nehme mir allzu oft allzu lange Pausen von solchen Telefonaten. Und die Telefonschnur wächst weiter.
Sehnsucht
Von meinen Tanten höre ich regelmäßig, wie sehr sie uns vermissen. Wenn ich ungeplant in ein Telefonat meiner Mutter mit ihren Geschwistern hineingerate, sagen sie dann melodramatische Dinge wie „Ich habe dein Gesicht vergessen“. Und obwohl sie Fotos von mir auf ihren Handys haben, auf denen sie jederzeit mein Gesicht anschauen können, stimmt es. Sie haben vergessen, wie es sich anfühlt mein Gesicht vor sich zu haben, meine Wangen zu küssen und meine Hand zu halten. Ich weiß meist auch sehr genau, was ich vermisse. Das versammelte Beisammensein und Geschichtenerzählen. Zum Kiosk gehen und Eis für alle Kinder kaufen. Das Rausschleichen mit dem Cousin, um heimlich zu rauchen. Aber es ist noch mehr. Es ist eine Sehnsucht nach einer Nähe, die ich als Dazukommende nur beobachten kann. Als mein Großvater gestorben ist, wusste ich meine Gefühle nicht richtig einzuordnen. Ich war traurig, aber vielmehr um die verpasste gemeinsame Zeit und um die vielen Erinnerungen, die wir nie geteilt haben. Und wenn ich die engen Beziehungen unserer Cousinen und Tanten untereinander sehe, werde ich neidisch. Ich beneide sie um ihre Nähe, um die Wärme und Liebe, die sie füreinander und für uns haben. Und ich fühle mich schuldig für die Distanz, die Ruhe und den Abstand, den ich mir genehmige und für das Leben in Sicherheit, das ich führen darf.
Illustration: Leon Scheich